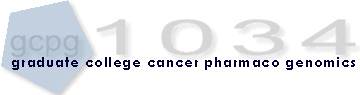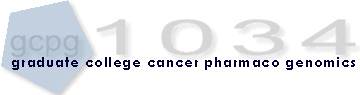Polymorphismen und seltene Varianten in Genen, die für
Proteine der DNA-Reparaturvorgänge codieren, gehören
zu den angeborenen potentiellen Risikofaktoren für die
Entwicklung maligner Tumore. Darüber hinaus können
derartige DNA-Reparatur-Genvarianten das Ansprechen eines Malignoms
auf eine Chemotherapie beeinflussen. Auch die Nebenwirkungen
einer Chemotherapie können durch DNA-Reparatur moduliert
werden.
Fragestellungen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, sind
u.a. wie Chemotherapie-induzierte DNA-Schäden von lebenden
menschlichen Zellen prozessiert werden. So können Aussagen über
die Gentoxizität und die Mutagenität der durchgeführten
Therapie getroffen und ein Therapie-spezifisches DNA-Mutationsspektrum
analysiert werden. Auch ein Vergleich der funktionellen DNA-Reparaturfähigkeit
für definierte DNA-Schäden von normalen Zellen und
Tumorzellen eines Individuums in Zusammenhang mit den Nebenwirkungen
und dem Ansprechen einer Chemotherapie kann durchgeführt
werden. Weitere Fragestellungen sind die mögliche Assoziation
von DNA-Reparaturgen-Polymorphismen mit den Nebenwirkungen
und dem Ansprechen einer Tumortherapie sowie der Effekt einer
unterschiedlichen relativen Expression von spontan alternativ
gesplicten mRNA-Varianten von DNA-Reparaturgenen auf die individuelle
DNA-Reparaturfähigkeit und damit auf das Ansprechen bzw.
auf die Nebenwirkungen einer Chemotherapie.
Diese Tumortherapie-bezogenen Aspekte sollen am Beispiel der
Therapie des malignen Melanoms mit Temozolomid, aber auch in
Kooperation mit den anderen Arbeitsgruppen des Graduiertenkollegs
bezogen auf gemeinsam interessierende Tumoren und Chemotherapeutika
untersucht werden.
Stand der Forschung:
Die Inzidenz des malignen Melanoms steigt schneller an als
jede andere Inzidenz eines bösartigen Tumors (Rigel
et al., 1996). Bei rechtzeitiger chirurgischer Entfernung
kann das maligne Melanom mit hoher Erfolgsrate kurativ therapiert
werden. Adjuvante Chemotherapien scheinen die Prognose nicht
verbessern zu können (Kretschmer et al., 2002). Treten
jedoch Fernmetastasen auf, sinkt die Jahresüberlebensrate
unter 20%. Jede therapeutische Intervention besitzt dann
lediglich palliativen Charakter (Keilholz et al., 2001).
Eine Standardtherapie für das fernmetastasierte maligne
Melanom existiert nicht. Dacarbazin (DTIC) als häufigste
Monotherapie hat eine etwa 15%ige Ansprechrate. Die mittlere
Ansprechdauer beträgt 5-6 Monate bei einer kompletten
Remissionsrate von etwa 5% (Serrone et al., 2000). Kombinationstherapien
(Polychemotherapien oder Chemo-Immuntherapien) können
zwar zu höheren Ansprechraten führen, jedoch konnte
bisher kein klarer Überlebensvorteil erzielt werden
bei erheblich stärkeren Nebenwirkungen für den
Patienten.
Temozolomid ist ebenso wie DTIC ein Pro-Drug des zytotoxisch
wirksamen Triazin 5-(3-methyl-triazen-1-yl) imidazol-4-carboxamid
(MTIC) (Newlands et al., 1992). Temozolomid zerfällt jedoch
bei physiologischem pH spontan zu MTIC und muss nicht aktiv
wie DTIC metabolisiert werden (Stevens et al., 1987). Auch
kann Temozolomid im Gegensatz zu DTIC die Blut-Hirnschranke
durchdringen. Durch die alkylierende Aktivität von MTIC
werden vornehmlich O6-Methyldeoxoguanin DNA-Addukte (O6-MeG)
generiert. Diese DNA-Schäden können durch die O6-Alkylguanin-DNA-Alkyltransferase
(Basen-Exzisions-Reparatur) eliminiert werden. O6-MeG führt
zur falschen Paarung mit Thymin (O6-MeG:T). Durch eine frustrane
Aktivierung des Mismatch-Reparatursystems kommt es zum programmierten
Zelltod (Pepponi et al., 2003). Wir wollen eine Temozolomidtherapie
von Melanompatienten auf der klinischen und molekulargenetischen
Ebene in bezug zu DNA-Schäden und dem Umgang menschlicher
Zellen mit diesen DNA-Schäden genauer untersuchen.
Polymorphisms and other variants of genes that encode proteins
involved in DNA repair processes comprise inherited potential
risk factors for the development of cancer. In addition, such
DNA repair gene variants may modulate tumor therapy responses
and the side effects of chemotherapy on an individual basis.
One question that arisis within this context is the processing
of chemotherapy-induced DNA damage by living human cells. This
allows the assessment of the genotoxicity and mutagenicity
of the chemotherapeutic regimen used and the analysis of the
therapy-specific mutational spectrum. Another research topic
comprises the comparison of the functional DNA repair capacity
for chemotherapy-induced DNA damage of normal cells and tumor
cells in a patient with respect to therapeutic response and
therapeutic side effects. Further research topics include the
association of DNA repair gene polymorphisms with side effects
and responses of a certain cancer therapy as well as the effects
of the relative expression of spontaneously alternatively spliced
mRNA variants of DNA repair genes on the individual DNA repair
capacity and, thus, on the response rate and side effects of
chemotherapies.
These tumor-therapy related aspects will be studied on the
example of metastatic melanoma treatment with temozolomide
but also in cooperation with the other members of the Graduiertenkolleg
with respect to other cancer entities and chemotherapeutics
that are of common interest.
The incidence of cutaneous melanoma rises steeper than the
incidence of any other cancer entity (Rigel et al., 1996).
Cutaneous melanoma can be cured with a high success rate,
if the tumor is sugically excised at an early state. Chemotherapies
given adjuvantly after surgery seem not to influence the
disease outcome (Kretschmer et al., 2002). If distant metastasis
occur, the one year survival rate drops below 20%. Any therapeutic
intervention is merely palliative at this stage (Keilholz
et al., 2001). A standard therapy for the treatment of metastatic
melanoma does not exist. Dacarbacine (DTIC) is the most commonly
used chemotherapy with a response rate of about 15%. The
mean duration of responses is 5 to 6 months and complete
remissions are seen in ~5% (Serrone et al., 2000). Polychemotherapies
or chemo-immunotherapies may lead to increased response rates,
but also to increased side effects and a significant impact
on patient survival could not be detected.
Temozolomide as well as DTIC are pro-drugs of the zytotoxic
substance triazine 5-(3-methyl-triazene-1-yl) imidazole-4-carboxamide
(MTIC) (Newlands et al., 1992). However, temozolomide decomposes
spontaneously at physiologic pH into MTIC in contrast to DTIC
that as to be actively metabolized into MTIC by liver enzymes
(Stevens et al., 1987). In addition, Temozolomide is able to
penetrate the blood-brain barrier. MTIC possesses alkylating
activity and predominantly generates O6-methyldeoxoguanine
DNA adducts (O6-MeG). These DNA adducts can be repaired by
the enzyme O6-alkylguanine-DNA-alkyltransferase (base-excision
repair). O6-MeG leads to mispairing with thymine (O6-MeG:T).
Due to futile activation of the mismatch DNA repair system
cellular apoptosis is induced (Pepponi et al., 2003). We propose
to investigate the therapy of metastatic melanoma with temozolomide
on the clinical and molecular-genetic level with respect to
DNA damage and the processing of temozolomide-induced DNA damage
by human cells.
Weiterführende Literatur