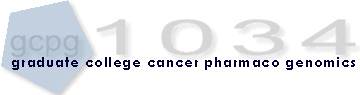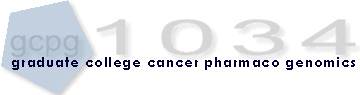Molekulare Untersuchungen polymorpher Marker an degradierter
DNA aus genetischen Archiven
Historische Anthropologie
Angeborene genetische Varianten beim Menschen werfen Fragen
nach ihrer funktionellen und evolutionsbiologischen Bedeutung
auf. Nahe liegende Erklärungsmodelle stellen Verbindungen
zwischen Polymorphismen und Morbiditäts- bzw. Mortalitätsrisiken
im Zusammenhang mit epidemischen Infektionskrankheiten her.
Bekannt sind außerdem die Parallelen in der Abwehr von
Infektionserkrankungen und der Abwehr von Tumorzellen.
Die Darstellung polymorpher Marker aus genetischen Archiven
kann Hinweise liefern, ob sich Allelfrequenzen von Polymorphismen
mit Bedeutung für Tumorerkrankungen von Jahrhunderten
gewandelt haben und ob die Bedeutung dieser Polymorphismen
im Zusammenhang mit epidemischen Infektionserkrankungen (z.B.
Pest, Cholera) zu sehen ist. Zur Beantwortung dieser Fragen
sind Methodenanpassungen an die spezifischen Charakteristika
alter und degradierter DNA und darauf aufbauend molekulargenetische
Untersuchungen an historischen Skelettserien und histopathologischen
Sammlungen vorgesehen, die unschätzbare genetische Archive
darstellen. Die Auswahl der genetischen Marker wird sich an
den in anderen Projekten als relevant erkannten Strukturen
orientieren, so zum Beispiel Zytokine (Interferon gamma, Tumor-Nekrosefaktor,
Interleukin 10) und Rezeptoren für bakterielle Lipopolysaccharide
(toll-like receptor 4) betreffen.
Die Untersuchung an archäologischen Skeletten werden ihren
inhaltlichen Schwerpunkt auf paläoepidemiologische relevante
Serien wie z.B. hochmittelalterliche Pest-Massenbestattungen
aus Norddeutschland vs. regional gleiches und zeitstellungsnahes
Kontrollmaterial legen und damit eine retrospektive und vergleichende
Epidemiologie sowie die Überprüfung heuristisch formulierter
Modellannahmen zu Selektionsparametern ermöglichen.
Die vorgesehenen Untersuchungen an histopathologischem Sammlungsmaterial
bieten die Möglichkeit, kurzfristig und effizient den
Zusammenhang zwischen genetischer Ausstattung und Krankheitsverläufen
in Abhängigkeit von spezifischen Therapien zu fokussieren.
Solche im Zentrum pharmakogenomischer Forschung angesiedelte
Fragestellungen können ansonsten ausschließlich
durch Langzeitstudien oder hilfsweise am Tiermodell beantwortet
werden.
Stand der Forschung
Vor rund einem Jahrzehnt gelangen die ersten erfolgreichen
PCR-gestützen Darstellungen mitochondrialer DNA und
chromosomaler DNA aus verschiedenen biogenen Quellenmaterialien,
darunter historische Skelettmaterialien sowie museale zoologische
und botanische Sammlungsbestände (s. Beiträge in
Herrmann und Hummel 1993). Seit dieser Zeit hat sich die „Ancient
DNA“-Analytik rasch in zahlreiche andere spezifische
Forschungszweige hinein entwickelt. So wurden zentrale Aspekte
der Stammesgeschichte des Menschen (z.B. Krings et al. 1997),
spezielle Fragen des Naturschutzes (z.B. Pertoldi et al.
2001) und Einzelfalluntersuchungen in der Geschichtsforschung
(z.B. Foster et al. 1998) aufgegriffen. Zahlreich sind die
Anwendungen in der Kriminaltechnik und solche vor politisch-völkerrechtlichem
Hintergrund (z.B. Corach et al. 1997). Im Bereich der Paläoepidemiologie,
einem der vielfältigen archäologisch-anthropologischen
Kontexte (vgl. auch Literaturliste der Arbeitsgruppe), gelangen
Nachweise von Tuberkulose-, Lepra- und Pesterregern aus historischem
Skelettmaterial (s. Beiträge in Greenblatt und Spigelman
2003). Ebenfalls in die historische Dimension konnten molekulare
Nachweise genetisch determinierter Erkrankungen vordringen,
neben Chromosomopathien (Tönnies et al. 1998) wurden
aus historischem Skelettmaterial genetische Abweichungen
nachgewiesen, für die ein Heterozygotenvorteil gesichert
ist (Sichelzellanämie; Faerman et al. 2000) oder aber
vermutet wird (Mukoviszidose; Bramanti et al. 2003). In der
medizinischen Grundlagenforschung wurden histopathologische
Sammlungen von Beginn an als wertvolle genetische Archive
erkannt und sowohl in größeren Studien als auch
in der Kasuistik genutzt. Neuere Arbeiten belegen, dass der
aus histopatholgischen Präparaten zu erzielende Informationsgewinn
durch Verknüpfung, Anpassung und Optimierung molekularer
Techniken noch bedeutend ausgeweitet werden kann (z.B. Junker
et al. 2003; Bonin et al. 2003).
Weiterführende Literatur
|
|